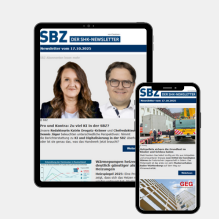Die Herausforderung, alte gegen neue Anlagentechnik auszutauschen, liegt nicht nur in der technischen Umsetzung, sondern beginnt bereits bei einer genauen Planung. Wer Wärmepumpen effizient und nachhaltig betreiben möchte, muss die hydraulischen und thermischen Gegebenheiten des Gebäudes genau kennen.
Planungssicherheit durch reale Messdaten
Traditionell basieren viele Heizungsplanungen auf theoretischen Annahmen, wie pauschalen Heizlasten, standardisierten Außentemperaturen und vereinfachten Anlagenhydrauliken. Doch gerade bei der Auslegung von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden führt diese Praxis oft zu überdimensionierten Systemen, ineffizientem Betrieb oder unzureichender Wärmeabgabe in kalten Wintertagen. Der wirtschaftliche Betrieb ist gefährdet und das Förderziel wird möglicherweise verfehlt.
Neue Ansätze sind notwendig: Statt mit Annahmen zu arbeiten, kommen reale Temperaturdaten zum Einsatz. Das Greentech-Unternehmen Mywarm arbeitet beispielsweise mit der Wärmepumpen-Ready-Analyse, die Echtzeitdaten als Grundlage für eine präzise Planung nutzt. Unter realen Bedingungen wird dargestellt, wie effizient und tragfähig eine Wärmepumpe in einem Gebäude oder Quartier arbeiten kann.
Ein zentrales Element ist dabei die raumweise Heizlastberechnung, die auf gemessenen Temperaturverläufen basiert. Sie ermöglicht es, die Heizflächen präzise zu dimensionieren, Komfortanforderungen realistisch einzuschätzen und die Wärmepumpe so auszulegen, dass sie möglichst lange im energieeffizienten Modulationsbereich betrieben werden kann.
Rohrdimension, Heizkörper und Heizkurve sind die Stellschrauben
Im Bestand sind die Heizkörper und Rohrleitungen meist auf hohe Vorlauftemperaturen (z. B. 70 °C) ausgelegt. Eine Wärmepumpe arbeitet hingegen am effizientesten bei niedrigen Vorlauftemperaturen von 35 bis 45 °C. Es stellt sich also die Frage, ob die vorhandene Infrastruktur überhaupt „wärmepumpentauglich“ ist.
Auch die Heizkörperauslegung verdient besondere Aufmerksamkeit. In vielen Fällen sind Heizkörper überdimensioniert, was den Einsatz von Wärmepumpen begünstigt. In anderen Fällen sind sie für den Betrieb mit niedriger Vorlauftemperatur jedoch unterdimensioniert. Hier gilt es, die Rahmenbedingungen für die Dimensionierung zu betrachten: Neben der Bauphysik, dem Wärmeabgabesystem und der Klimazone spielen auch Energie- und Fixkosten für ein zweites Heizsystem eine Rolle. Entscheidend ist hier, welche Raumtemperaturen bei bestimmten Außentemperaturen tatsächlich erforderlich sind. Dabei handelt es sich folglich um Komfortszenarien, die individuell betrachtet werden müssen.
Muss ein Raum beispielsweise auch bei –12 °C zuverlässig 21 °C erreichen, kann ein Heizkörpertausch notwendig werden, wenn er diese Leistung bei Wärmepumpen-Betriebstemperaturen nicht mehr erbringt. Ein hydraulischer Abgleich schafft Klarheit über die tatsächliche Verteilung der Heizleistung im System und ist mittlerweile auch bei Wärmepumpen eine zuverlässige Vorgehensweise. Der hydraulische Unterschied nach Umstellung auf eine Wärmepumpe liegt in der Erhöhung des Durchflusses und der daraus resultierenden Reduktion der Spreizung.
Als letzter Schritt muss die Heizkurve, die das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt, analysiert werden. Eine zu steile Kurve führt zu unnötig hohen Temperaturen und damit zu Effizienzverlusten. Eine zu flache Kurve birgt das Risiko von Komforteinbußen. Ziel ist es, eine Heizkurve zu definieren, die den besten Kompromiss aus Effizienz und Behaglichkeit bietet – und das für jedes Gebäude individuell. So explodieren die Energiekosten nicht und die zu beheizenden Räume werden angemessen warm.
Monovalent oder bivalent? Die Rolle des Spitzenlastkessels
In unsanierten Altbauten mit schlechter Dämmung kann der Wärmebedarf an sehr kalten Tagen die Leistungsgrenze einer Wärmepumpe überschreiten. Hier stellt sich die Frage, ob ein monovalenter Betrieb möglich oder ein bivalentes System mit Spitzenlastkessel sinnvoll ist. Die Antwort liefert eine exakte Heizlastanalyse: Reicht die Wärmepumpenleistung aus, um auch unter ungünstigsten Bedingungen (z. B. –12 °C Außentemperatur) durch ausreichend dimensionierte Heizkörper die notwendige Raumwärme zu liefern, kann ein monovalentes System wirtschaftlich und nachhaltig betrieben werden.
Einen allgemeingültigen, objektiven Wert, wann ein monovalentes System ausreicht bzw. ein bivalentes System vonnöten ist, gibt es nicht. In diesem Zusammenhang sind auch Faktoren wie die Bauqualität und die Nutzungslast zu berücksichtigen. Ist ein monovalentes Heizsystem nicht ausreichend, bietet sich ein bivalenter Betrieb an – etwa mit einem bestehenden Gas- oder Ölkessel, der nur bei Bedarf zuschaltet. Eine präzise Planung hilft, überdimensionierte Wärmepumpen zu vermeiden, die nicht nur unnötig teuer sind, sondern auch ineffizient arbeiten. Gleichzeitig werden Anlagen vermieden, die in der Praxis nicht den nötigen Komfort bieten. Auch hier helfen echte – vor Ort erhobene – Daten, um die Planung zu präzisieren.
Pflicht und Chance zugleich
Der hydraulische Abgleich ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben (GEG, BEG), sondern auch essenziell für einen effizienten Betrieb. Ohne ihn fließt das Heizwasser nicht dorthin, wo es gebraucht wird, und das kann insbesondere bei Wärmepumpen zu gravierenden Effizienzverlusten führen. Ein professionell durchgeführter Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper die notwendige Wassermenge erhält und die gesamte Anlage in Balance arbeitet.
Durch einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B, inkl. VdZ-Nachweisformularen zur Bestätigung, wird nicht nur die gesetzliche Voraussetzung für eine Förderung erfüllt, auch die Betriebssicherheit und Effizienz der gesamten Anlage steigen. Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Wirkung des Abgleichs auf die Geräuschentwicklung und Lebensdauer der Umwälzpumpe. Auch Strömungsgeräusche, häufige Taktraten und unnötig hoher Stromverbrauch lassen sich hierdurch deutlich reduzieren.
Wie der messwertbasierte hydraulische Abgleich funktioniert
Beim messwertbasierten hydraulischen Abgleich werden zunächst alle relevanten Daten der Heizungsanlage digital erfasst – darunter Position, Art und Typ jedes Heizkörpers und Wärmetauschers, die Heizkreiszuordnung sowie die Informationen zu Pumpentypen, deren Leistung und aktuellen Einstellungen. Auch die Konfiguration der Strangregulierventile und die Daten zur Wärmeerzeugung bzw. -bereitstellung fließen in die Analyse ein. Auf Basis dieser Datengrundlage erfolgt im Volllastbetrieb eine temperaturgestützte Messung, bei der das tatsächliche Verhalten der Anlage detailliert ausgewertet wird.
Auf Grundlage dieser Auswertung wird ein digitales Anlagenmodell erstellt, das die Durchflussmengen und Temperaturdifferenzen aller Heizkörper simuliert. Anschließend erfolgt eine präzise Berechnung der optimalen Einstellwerte für jedes Thermostatventil. Die Ventile werden anschließend automatisiert über smarte Stellmotoren (z. B. über Funk) angesteuert und auf den idealen Durchfluss eingestellt. So erreicht jeder Raum exakt die benötigte Wärme.
Das Verfahren ermöglicht nicht nur die präzise Berechnung der optimalen Durchflussmengen, sondern deckt auch hydraulische Fehlkonfigurationen auf – etwa Fehlanschlüsse oder falsch eingestellte Überstromventile. Bei Mywarm überwacht ein zentrales Leitstand-Team das gesamte Projekt in Echtzeit und unterstützt die Servicetechniker vor Ort. Der hydraulische Abgleich gleichwertig zu Verfahren B, inkl. VdZ-Nachweisformularen zur Bestätigung, erfüllt nicht nur die gesetzliche Voraussetzung für eine Förderung, er steigert auch die Betriebssicherheit und Effizienz der gesamten Anlage.
Fazit: Reale Messdaten statt theoretischer Annahmen
Der effiziente Betrieb einer Wärmepumpe beginnt nicht mit dem Einbau, sondern mit einer faktenbasierten Planung. Wer reale Messdaten, raumweise Heizlasten, korrekte Heizkurven und hydraulischen Abgleich berücksichtigt, stellt sicher, dass die Wärmepumpe nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich arbeitet. Gerade im Bestand ist dies der Schlüssel zur erfolgreichen Wärmewende.

Bild: Mywarm

Bild: Mywarm
Mehr hydraulischer Abgleich online
Neugierig geworden? Weitere Beiträge zum Thema hydraulischer Abgleich gibt es online: http://bit.ly/3IOw1tS