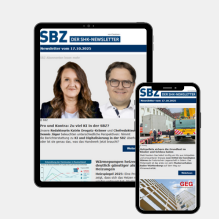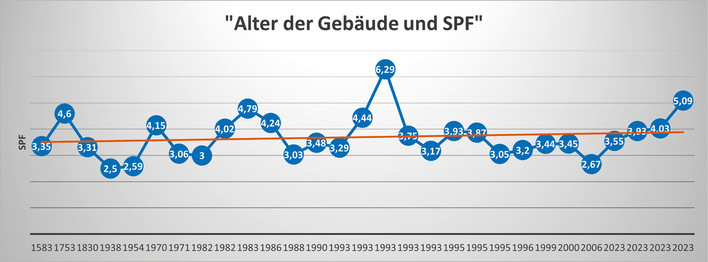Es ist das, was man einen klassischen Zielkonflikt nennt: Auf der einen Seite steht die Forderung, im Sektor Bauen/Wohnen Energie einzusparen, denn schließlich verursacht dieser Sektor mit 36 % (Quelle: EU-Kommission) einen wesentlichen Anteil der klimaschädlichen CO2-Emissionen. Der weitaus größte Teil entfällt davon auf Raumwärme. Es muss also Wärme „gespart“ werden, um erst den Energieverbrauch und dadurch auch den CO2-Ausstoß zu senken. Folgerichtig werden Häuser gedämmt. Das KfW-Effizienzhaus 40 Plus gibt die Richtung vor; Stichwort: „Thermoskanneneffekt“.
Auf der anderen Seite steht die gesundheitliche und baubiologische Notwendigkeit, dass Wohnen ohne ein Mindestmaß an Frischluftaustausch aber auch nicht funktioniert: Legt man die DIN 1946-6 zugrunde, braucht es in Wohngebäuden pro Person zwischen 20 und 30 m³/h an Frischluft. Das entspricht einer Luftwechselrate, die bei typischen Wohnbedingungen bei mindestens 0,4 liegt – was in gut gedämmten und hochdichten Gebäuden über natürliche Infiltration durch Gebäudeleckagen nicht zu erreichen ist.
Gelöst werden kann diese Problematik über eine korrekt dimensionierte kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL), was jedoch mit einem gewissen planerischen und baulichen Aufwand sowie Kosten verbunden ist. Nicht ohne Grund wurde bei Einführung des Gebäudetyps E wieder über eine angeblich hinreichende Fensterlüftung gesprochen. Auch die Bayerische Architektenkammer schlägt in diese Kerbe, wenn sie beispielsweise für Sanierungen die Erhaltung einer natürlichen Fensterlüftung fordert. Werden zugige Bestandsfenster im Rahmen der Sanierung ausgetauscht, sei es sinnvoll, Fensterfalzlüfter einzubauen. In Kombination mit einer mechanischen Abluft im Badezimmer mit Feuchtesensor ließen sich Feuchtigkeitsprobleme vermeiden, so die Kammer. (Quelle: www.byak.de/ben-blog/; März 2025)
Für Prof. Dr.-Ing. Thomas Hartmann vom Institut für Technische Gebäudeausrüstung (ITG) in Dresden greift diese Betrachtung jedoch zu kurz: Er weist darauf hin, dass zwar das wirtschaftliche Umfeld derzeit ausgesprochen schwierig sei, gleichzeitig aber gerade bei Bestandssanierungen – die den größten Teil der Bauaktivitäten ausmachen – der Nutzen durch Schadensvermeidung durch kontrollierte Lüftungsanlagen nicht unterschätzt werden dürfe. Zudem entstünden dabei keine nennenswerten energetischen Verluste, da die Wärmerückgewinnungsquote von KWL-Anlagen im Durchschnitt deutlich über 80 % liege.
Push-Pull-Ventilatoren nur ein Kompromiss
Ein Lösungsansatz wäre für Prof. Dr. Hartmann vor diesem Hintergrund – insbesondere bei Sanierungen – zum Beispiel, auf Push-Pull-Lüfter zu setzen. Für die Belüftung von fensterlosen Bädern und Toilettenräumen ist dann zwar immer noch ein zusätzliches Lüftungssystem nach DIN 18017-3 notwendig, das aber in vielen Bestandsbauten ohnehin vorhanden ist.
Lüftungsexperte Reiner Hackl vom Hersteller Systemair GmbH in Boxberg schränkt jedoch ein, dass für die normgerechte Funktion – u. a. zur Verhinderung von Schimmel – eine fachgerechte Auslegung der Einzellüfter vorausgehen sollte. Häufig sei beispielsweise festzustellen, dass die Leistung der paarweise eingesetzten Lüfter zwar rechnerisch die benötigte Luftmenge abbildet, dabei jedoch Wechselbetrieb außer Acht gelassen wird. Die geforderte Luftwechselrate kann auf diese Weise nicht erreicht werden und im Extremfall wird nur etwa die Hälfte erreicht. Eine erhöhte Feuchtebelastung im Raum lasse sich dabei nicht vermeiden, so Hackl. Werden stattdessen ausreichend dimensionierte, dezentrale Lüfter installiert, steigen sowohl die Kosten als auch die Geräuschbelästigung durch die Ventilatoren. Push-Pull-Ventilatoren bleiben somit stets ein Kompromiss.
„RAV-Control“ als innovativer Ansatz
Erforderlich wird ein Spagat zwischen Aufwand, Energieeffizienz und Praktikabilität in der Umsetzung und Funktionserfüllung im Sinne der DIN 1946-6. Einen Ausweg sieht Prof. Dr. Hartmann vor diesem Hintergrund in einer Neuentwicklung, die „das für Wohngebäude Beste aus zwei Welten in sich vereint“. Das System „RAV-Control“ bietet für KWL-Anlagen eine tatsächlich bedarfsgerechte Einzelraumregelung, ähnlich wie sie von Flächentemperiersystemen bekannt ist.
Er erläutert, dass das bisherige Auslegungskonzept aus Zu- und Ablufträumen dafür grundlegend verändert wird. Die Zuluftführung erfolgt künftig beispielsweise über den zentralen Flur, während alle anderen Räume als Ablufträume fungieren. Eine hoch entwickelte Elektronik sorgt über entsprechende Sensoren im RAV-Verteiler dafür, dass, abhängig von CO₂-Belastung und Feuchte, über automatisch gesteuerte Lüftungsklappen genau die Luftmenge in die Räume gelangt, die für einen gesunden Luftwechsel erforderlich ist.
Das spart beträchtlich Energie in der Betriebsphase, so Hackl. Er lobt, dass durch die dynamische Verteilung der effektiv benötigten Frischluftmenge wesentlich weniger Zuluft gefördert werden muss, als dies mit einer zentral geführten Bedarfsregelung im Lüftungsgerät der Fall ist. Er geht von einer Einsparungshöhe von etwa 30 % aus. Zudem sei der Luftaustausch hygienischer, da belastete Raumluft bei diesem Konzept nicht über andere Räume geführt, sondern direkt abgeleitet werde.
Einfachere Auslegung
Die Installation und Auslegung der KWL-Anlage nach dem Konzept RAV-Control ist in jeder Hinsicht einfacher, betont Hackl, da die Lüftungskanäle im Gegensatz zu gängigen Auslegungsmaßstäben nicht mehr unterschiedlich dimensioniert und die Zuluftventile nicht mehr einreguliert werden müssen: Unabhängig vom Raumvolumen wird eine KWL-Anlage immer auf den maximalen Luftaustausch pro Quadratmeter und Stunde ausgelegt. Die Regulierung erfolgt über die Kontrolle der Luftqualität und die automatisch regelnden Lüftungsklappen in den Abluftkanälen. Aufgrund der dynamischen Volumenstromregelung ergibt sich somit gleichzeitig bei identischer Dimensionierung der Lüftungsanlage ein höheres Fördervolumen pro Raum. Die Frischluft ist immer genau in dem Raum vorhanden, in dem sie benötigt wird – unabhängig davon, ob es kurzfristige Belastungsspitzen gibt, etwa durch eine Party, oder ob einzelne Zimmer längere Zeit nicht genutzt werden, so Hackl. Durch die gemeinsame Entwicklung von Systemair als Lüftungshersteller und dem Smart-Home-Technologieunternehmen eQ3 kann RAV-Control dabei auch direkt in die Welt der Homematic-Gebäudeautomation eingebunden werden.
Etwas anders auslegen
Bei der Auslegung stehen Planer und ausführende Fachhandwerker derzeit (noch) vor der Herausforderung, dass sich das Schema der DIN 1946-6 nicht direkt auf RAV-Control übertragen lässt. Der Grund: Die klassische Trennung in Zu- und Ablufträume entfällt – auch wenn der Gesamtluftmengenbedarf der Wohnung weiterhin unstrittig bleibt. In der Praxis wird die Zuluft nun mit einem berechnungstechnisch vergleichbaren Volumenstrom in einen zentralen Zuluftraum (meist den Flur) geführt, während die Abluftkanäle in den einzelnen Räumen entsprechend kleiner ausgelegt werden können. Im Ergebnis entsteht also im Wesentlichen lediglich eine neue Verteilungslogik.
Um Klarheit im Sinne von Planungssicherheit zu schaffen, hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) die FAQ zur DIN 1946-6:2019-12 um den Punkt 8 „Auslegung von raum- bzw. zonenweise bedarfsgeführten Lüftungssystemen ohne Mehrfachnutzung“ erweitert. Eine der FAQ lautet: „Wie kann die Auslegung für raum- bzw. zonenweise bedarfsgeführte Lüftungssysteme umgesetzt werden, bei denen keine Mehrfachnutzung der Luft nach DIN 1946-6, Abschnitt 5.2.2 (also Luftüberströmung von Zulufträumen in Ablufträume) erfolgt?“ Die Antwort lautet u. a., indem „mindestens der notwendige Außenluftvolumenstrom für Nutzungseinheiten für die Nennlüftung nach Gleichung 28 sichergestellt wird und Anforderungen an innenliegende Räume nach DIN 18017-3 sowie nach der Bauaufsichtlichen Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen eingehalten werden“. Zudem sei „in jedem Raum entsprechend seiner grundsätzlichen Zuordnung als Abluft- oder Zuluftraum mindestens der Luftvolumenstrom nach Tabelle 16 oder nach Tabelle 17“ sicherzustellen und es müsse „in jedem Raum bzw. in jeder Zone die Anpassung des Luftvolumenstroms an den Bedarf möglich“ sein.
Fazit
Unter dem Einfluss des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist die Technische Gebäudeausrüstung – hier: der Bereich Heizung, Klima, Lüftung (HKL) – massiv unter Druck geraten: Der detailliert betrachtete Energieaufwand der einzelnen Gewerke spielt eine wichtigere Rolle als in der Vergangenheit. Mit dem System RAV-Control ist ein innovativer Entwicklungsschritt gelungen, das Bau-Los „kontrollierte Wohnungslüftung“ unter funktionalen, technischen und energetischen Aspekten einen großen Schritt voranzubringen: Die Schutzziele „Absicherung der Innenraumluftqualität“ und „Feuchteschutz“ werden deutlich bedarfsgerechter und energieeffizienter erreicht, als dies mit dem bisherigen Konstrukt aus separaten Zu- und Ablufträumen möglich ist.
Mehr Lüftungstechnik online
Neugierig geworden? Weitere Beiträge zum Thema Lüftungstechnik gibt es online: