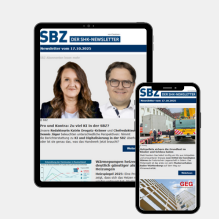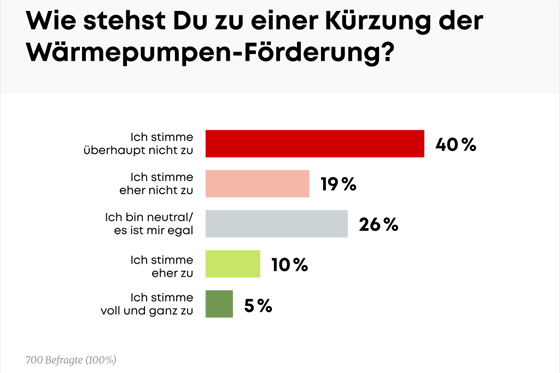SBZ: Herr Schmidt, warum hat Viessmann Climate Solutions ein Akustiklabor in Allendorf errichtet? Stehen hierbei Kosten und Nutzen im Verhältnis?
Thorsten Schmidt: Niemand will durch Lärm belästigt werden. Die Investition in ein Akustiklabor ist daher eine direkte Investition in ein wichtiges Kundenbedürfnis. Im Kontext der Wärmewende kommt der Wärmepumpentechnologie eine Schlüsselrolle zu, denn sie ermöglicht den Ersatz fossiler Brennstoffe durch elektrische Lösungen.
SBZ: Inwiefern spielt das Thema Schall bei Wärmepumpen eine Rolle?
Schmidt: Wärmepumpen nutzen zur Warmwasserbereitung einen thermodynamischen Kaltdampfprozess, der einen Kältemittelverdichter und bei Luft/Wasser-Wärmepumpen zusätzlich einen Ventilator erfordert. Beide Komponenten erzeugen Geräusche. Wird die Akustik bei der Entwicklung und Konstruktion von Wärmepumpen nicht angemessen berücksichtigt, kann der entstehende Schall zu einer Belästigung von Nutzern und Anwohnern führen.
SBZ: Lassen sich konstruktive Maßnahmen aus den Prüfergebnissen im Akustiklabor für die Forschung und Entwicklung von Wärmepumpen ableiten?
Schmidt: Selbstverständlich ist es unser Ziel, die Wärmepumpen leiser zu machen. Daher ist es unerlässlich, die Geräuschentstehungsmechanismen und Übertragungswege genau zu verstehen. Dank moderner Akustikprüfstände und komplexer Messmethoden untersuchen wir zuerst die Komponenten hinsichtlich ihrer akustischen Eigenschaften. Anschließend werden die Wechselwirkungen im Gesamtsystem prognostiziert und optimiert. Auf diese Weise ist eine gezielte Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik möglich.
SBZ: Welche Ergebnisse erzielen Sie konkret mit diesen Maßnahmen?
Schmidt: Sehr gute! Die von uns entwickelten Produkte gehören zu den leisesten ihrer Art. So haben wir zum Beispiel mit der neuen Vitocal 250-A 19 kW einen neuen Maßstab in dieser Leistungsklasse gesetzt. Die Wärmepumpe zeichnet sich durch eine sehr geringe Schallemission aus und hat eine Geräuschcharakteristik, bei der tieffrequente tonale Anteile vermieden werden. Diese wären vor allem in ruhigen Gebieten und in der Nacht besonders störend.
SBZ: Welche Ziele verfolgen Sie in der weiteren Entwicklung?
Schmidt: Es gibt bereits Wärmepumpen mit sehr guter Akustik. Leider ist die Geräuschkennzeichnung von leistungsgeregelten Wärmepumpen sehr intransparent. Dadurch ist es schwierig, anhand von Datenblättern und Marketingunterlagen akustisch gute von schlechten Produkten zu unterscheiden. Oft wird dies erst nach der Inbetriebnahme festgestellt. Eine nachträgliche Verbesserung der Akustik ist zum einen dann meist mit sehr hohem Aufwand verbunden und zum anderen in der Regel wenig effektiv. Die Entwicklung zukünftiger Regelwerke sollte daher darauf abzielen, die Transparenz von Wärmepumpengeräuschen zu erhöhen.
SBZ: Ist es möglich, dass Wärmepumpen noch leiser werden?
Schmidt: Gute Wärmepumpen sind heute bereits so leise, dass ihre Geräusche unter den typischen Umgebungsgeräuschen liegen. Akustisch optimierte Geräte sind daher kaum wahrnehmbar.
SBZ: Inwiefern beeinflusst die Lautstärke die Leistungsfähigkeit von Außeneinheiten?
Schmidt: Es ist zu unterscheiden, ob die Lärmminderung konstruktiv oder nur methodisch, beispielsweise durch eine deutliche Reduzierung der Lüfterdrehzahl, erreicht wurde. Im letzteren Fall führt der reduzierte Luftmassenstrom zu einem Effizienzverlust. Durch unsere Prüfstandsmöglichkeiten und die Berücksichtigung der Akustik bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase sind wir in der Lage, Produkte ganzheitlich zu optimieren. Das Ergebnis sind leistungsstarke Produkte mit einer hohen Effizienz und gleichzeitig geringer Schallemission. Und nebenbei sehen sie auch noch richtig gut aus.

Bild: Viessmann
SBZ: Wie kann das SHK-Handwerk Schallleistungspegel richtig einordnen? Die Herstellerdaten sind ja nicht immer direkt miteinander vergleichbar.
Schmidt: Es gibt heute bereits akustisch sehr gute Luft/Wasser-Wärmepumpen, die selbst bei dichter Bebauung keine Belästigung erzeugen. Geräuschemissionen können den Herstellerunterlagen oder zum Beispiel der Schalldatenbank des Bundesverbands Wärmepumpe BWP entnommen werden. Leider sind die Werte, insbesondere maximale Schallleistungspegel, intransparent und können nicht immer miteinander verglichen werden, da es bei der Kennzeichnungspflicht keine einheitlichen Vorgaben gibt. Qualitätsprodukte, die typischerweise nicht die billigsten Produkte sind, haben üblicherweise zuverlässige Angaben. Die guten Akustikwerte werden bei diesen Produkten konstruktiv erreicht, also ohne dass durch einen Eingriff in die Regelungsmethode –zum Beispiel durch ein deutliches Reduzieren der sonst üblichen Ventilatordrehzahl – die Effizienz negativ beeinflusst wird. Ein Produkt, das im Nachtzeitraum eine Schallleistung von weniger als 50 dB(A) aufweist und gleichzeitig keine tieffrequenten Geräuschanteile emittiert, wird in der Regel als leises Gerät wahrgenommen.
SBZ: Was sind die Ursachen niederfrequenter Schallemissionen und wie können diese Werte reduziert werden?
Schmidt: Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen können tieffrequente Geräuschemissionen von den Ventilatoren erzeugt werden. Die sogenannte Blatt-Folge-Frequenz ist ein wesentlicher Geräuschentstehungsmechanismus. Darüber hinaus erzeugen Kältemittelverdichter tieffrequente, tonale Geräusche, die durch Resonanzeffekte verstärkt werden können. Durch ein hohes Systemverständnis und einen systematischen akustischen Entwicklungsprozess lassen sich diese Effekte vermeiden.
SBZ: Und wodurch werden hochfrequente Schallemissionen erzeugt und wie werden sie reduziert?
Schmidt: Hochfrequente Geräuschanteile können unter anderem durch die Leistungselektronik hervorgerufen werden. Moderne Wärmepumpen sind drehzahlgeregelt, sodass die Leistungen permanent an den aktuellen Bedarf angepasst werden können. Dies erhöht die Effizienz der Systeme, kann jedoch zu hochfrequentem Fiepen oder Summen führen. Durch optimierte Motorsteuerungen lassen sich die mechanischen Vibrationen reduzieren. Zusätzlich können die hochfrequenten Geräusche konstruktiv sehr gut optimiert werden.
SBZ: Welchen Einfluss hat der Aufstellort auf die Geräuschemissionen?
Schmidt: Geräusche können durch einen ungünstigen Aufstellort lauter werden. Bei gleichbleibenden Geräuschemissionen führt die Reflexion des Schalls an Wänden oder sonstigen schallharten Oberflächen zu einer Erhöhung des Schalldruckpegels. Dadurch führt die Aufstellung einer Wärmepumpe in einer Ecke zu einer Pegelerhöhung von 6 dB im Vergleich zu einer freien Aufstellung, was dann deutlich wahrnehmbar ist.
SBZ: Was kann unternommen werden, wenn der Betrieb einer Außeneinheit nachts als störend empfunden wird?
Schmidt: Die Auswahl einer adäquaten Wärmepumpe sollte bereits unter Berücksichtigung des Geräuschverhaltens erfolgen. In der Nacht sind die Umgebungsgeräusche leiser, weshalb tieffrequente, tonale Geräuschanteile mit zu hohen Pegeln am Immissionsort als störend wahrgenommen werden. Nachträgliche Verbesserungen dieser Frequenzanteile sind jedoch nur begrenzt möglich. Die Umpositionierung der vorhandenen Anlage kann eine Lösung darstellen.
SBZ: Wohin wird sich Ihrer Meinung nach das gesamte Thema noch entwickeln?
Schmidt: Sobald das beschriebene Geräuschniveau erreicht ist, besteht keine zwingende Notwendigkeit, das Produkt noch leiser zu machen. Für den Einsatz in klassischen Einfamilienhäusern, sowohl im Bestand als auch im Neubau, stehen bereits geeignete Lösungen zur Verfügung. Bei der Sanierung von Mehrfamilienhäusern sind höhere Heizleistungen erforderlich. Dabei gilt: Maschinen mit höherer Leistung sind in der Regel lauter als solche mit geringer Leistung. Die Herausforderung besteht nun in der weiteren akustischen Optimierung von Produkten mit höheren Leistungen.
SBZ: Herr Schmidt – ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch.

Bild: Viessmann
Mehr Wärmepumpe online
Neugierig geworden?
Weitere Artikel rund um Wärmepumpen gibt es online unter:
www.sbz-online.de/tags/waermepumpe